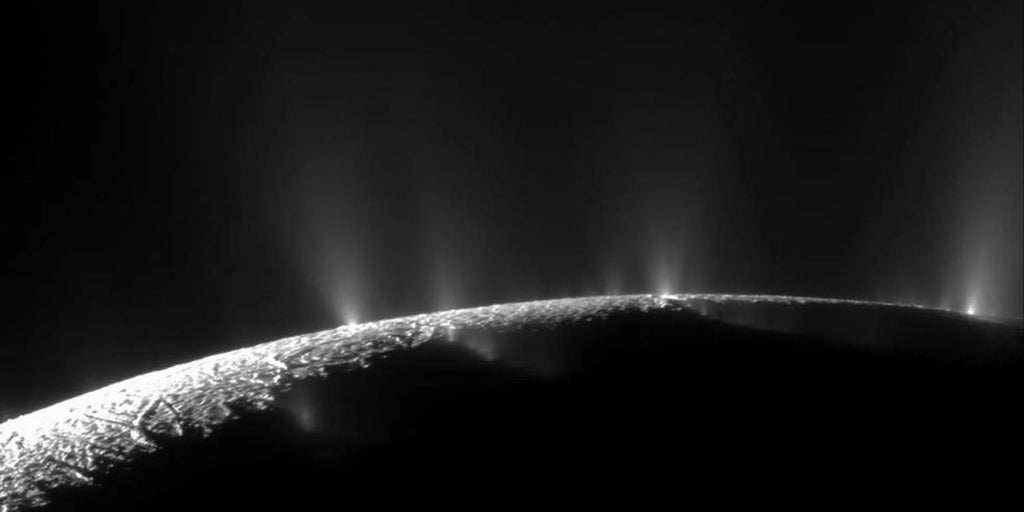María Eugenia Estenssoro: „Ohne Wissenschaft gibt es keinen wirtschaftlichen Fortschritt“

Es besteht kein Zweifel mehr. Wissenschaftliche und technologische Innovation sowie schöpferische Zerstörung (die kontinuierliche Entwicklung neuer Technologien, die alte ersetzen) sind die Motoren nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung.
Der österreichische Ökonom Joseph Schumpeter entwickelte das Konzept 1942, doch wurde es nun von Joel Mokyr, Philippe Aghion und Peter Howitt nach jahrzehntelangen, akribischen theoretischen und empirischen Studien zur Wirtschaftsleistung wohlhabender Nationen bestätigt. Die Schwedische Akademie verlieh ihnen in diesem Jahr den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften.
Seine Wahl begründete er mit einem Dokument mit dem Titel „Von der Stagnation zur nachhaltigen Entwicklung“, in dem er erklärt, dass sich der Lebensstandard über weite Strecken der Menschheitsgeschichte trotz vereinzelter Entdeckungen von einer Generation zur nächsten nicht wesentlich verändert habe. Dies änderte sich vor zweihundert Jahren mit der Industriellen Revolution. Ausgehend von Großbritannien und sich dann auf andere Länder ausbreitend, führten technologische Innovationen und wissenschaftlicher Fortschritt zu einem endlosen Kreislauf von Innovation und Fortschritt.
 María Eugenia Estenssoro
María Eugenia EstenssoroDer direkte Zusammenhang zwischen wissenschaftlichen Fortschritten und deren Anwendung zur Verbesserung der Produktion und des gesellschaftlichen Wohlergehens mag neu erscheinen, doch die großen Denker des 19. Jahrhunderts wussten dies bereits. 1863, während des Bürgerkriegs, gründete Präsident Abraham Lincoln die United States Academy of Sciences. Auf Nachfrage erklärte er, die Bestimmung seines Landes sei nicht das Überleben, sondern der Fortschritt, und die Wissenschaft sowie ihr Beitrag zum Gemeinwohl seien unerlässlich.
Mit derselben Vision gründete Präsident Domingo Sarmiento zwischen 1869 und 1872 die Nationale Akademie der Wissenschaften, das Nationale Meteorologische Amt, die Argentinische Wissenschaftliche Gesellschaft, die Astronomische Sternwarte und die Fakultät für Physik und Exakte Wissenschaften von Córdoba. Er lud außerdem Wissenschaftler aus den Vereinigten Staaten und Europa ein, diese Institutionen zu leiten und zu bereichern.
Seinen zahlreichen Kritikern entgegnete er: „Es sei verfrüht oder überflüssig, sagen sie, bei jungen Völkern mit einem entweder erschöpften oder übervollen Schatz. Nun, ich sage, wir müssen auf den Rang einer Nation oder den Titel eines zivilisierten Volkes verzichten, wenn wir nicht unseren Anteil am Fortschritt und der Weiterentwicklung der Naturwissenschaften leisten.“
Zweihundertfünfzig Jahre später, mitten im Wissenszeitalter, debattieren die Argentinier immer noch darüber, ob Wissenschaft und Technologie für nachhaltigen wirtschaftlichen Fortschritt notwendig sind. Obwohl Argentinien als einziges lateinamerikanisches Land drei Nobelpreise in den Naturwissenschaften gewonnen hat, halten viele führende Politiker dies für einen „Luxus“, den wir uns nicht leisten können. Sie verkennen dabei, dass wir arm und unterentwickelt bleiben werden, solange wir hochwertige Bildung, Wissenschaft und Technologie nicht in den Mittelpunkt einer mittel- und langfristigen Produktivitätsstrategie stellen.
Dies wurde von den großen Industriemächten des 20. Jahrhunderts sowie von vielen ärmeren und weniger entwickelten Ländern als uns, darunter Irland, Südkorea, Island, Estland, Singapur und China, demonstriert, die innerhalb weniger Jahrzehnte ihr BIP und den Lebensstandard ihrer Einwohner durch technologische Führung vervielfachten.
Makroökonomische Stabilität ist eine grundlegende Voraussetzung für wirtschaftliche und soziale Entwicklung – eine Tatsache, die dank des Engagements von Präsident Javier Milei zunehmend verstanden wird. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass dies allein nicht ausreicht. Für ein nachhaltiges Wachstum in dem Maße, wie es notwendig ist, um Millionen von Argentiniern aus der Armut zu befreien und eine prosperierende Gesellschaft zu schaffen, ist sie unzureichend . Um dies zu erreichen, müssen wir unsere Produktionsstruktur diversifizieren und die Wertschöpfung steigern; das heißt, mehr in Wissenschaft und Technologie investieren und Innovationen vorantreiben.
Genau das tat China. Zwei Jahrzehnte lang war es das Billigproduktionszentrum für die USA und Europa und profitierte von einer nahezu sklavenähnlichen Arbeitskraft und einem riesigen Markt. Gleichzeitig entsandte es, ohne sich auf ein falsches Souveränitätsgefühl zu berufen, Hunderttausende chinesische Studenten, um an seinen Universitäten das amerikanische Modell zu studieren. Heute ist China führend in Wissenschaft und Technologie, mit doppelt so vielen Patenten pro Jahr wie sein Erzrivale, und seine Wirtschaft steht in direktem Wettbewerb mit der der USA. Im Jahr 2000 lag das Pro-Kopf-Einkommen in China bei 1.000 US-Dollar jährlich; heute beträgt es 13.000 US-Dollar, genauso viel wie in Argentinien.
Bislang hat Präsident Javier Milei mit seiner Wissenschaftspolitik genau das Gegenteil erreicht. Seit seinem Amtsantritt hat er den Wissenschaftssektor massiv angegriffen, und das Budget für Wissenschaft und Technologie ist auf magere 0,2 % des BIP gesunken – ein historischer Tiefstand, vergleichbar mit dem des kritischen Jahres 2002. Die Unzufriedenheit in der Wissenschaftsgemeinschaft ist weit verbreitet.
Am 30. Oktober veröffentlichte das Sekretariat für Innovation, Wissenschaft und Technologie ohne großes Aufsehen die Resolution 282/2025 im Amtsblatt. Diese legt Richtlinien fest, um wissenschaftliche Forschung und technologische Innovation in vier Prioritätsbereichen – Agrarwirtschaft, Energie und Bergbau, Wissensökonomie und Gesundheit – produktionsorientiert auszurichten. Die Entscheidung ist zu begrüßen! Um zu wissen, ob die Situation tatsächlich verbessert wird, müssen wir wissen, welche Mittel im vom Kongress zu beratenden Haushalt bereitgestellt werden und ob ein konkreter Plan mit Programmen, Finanzierungsquellen, Zeitplänen und messbaren Zielen vorgelegt wird. Andernfalls bleibt es womöglich nur eine lange Liste guter Absichten. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte das Sekretariat unsere Anfrage noch nicht beantwortet.
 Conicets Streaming-Angebot über die Geheimnisse des Meeres
Conicets Streaming-Angebot über die Geheimnisse des MeeresFernando Stefani: „Die Situation ist katastrophal; man spricht bereits von ‚Wissenschaftsmord‘. Es handelt sich um eine gezielte und sehr rasante Zerstörung von Forschungskapazitäten“, so der Direktor des Zentrums für Bionanowissenschaften beim CONICET (Nationaler Rat für wissenschaftliche und technische Forschung). Stefani ist promovierter Naturwissenschaftler und Träger der Otto-Hahn-Medaille der renommierten Max-Planck-Gesellschaft. Neun Jahre lang arbeitete er in Deutschland und leitete Teams, die mit großen Konzernen zusammenarbeiteten, um deren Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Nach seiner Rückkehr nach Argentinien im Jahr 2009 entdeckte er eine historisch gewachsene Diskrepanz zwischen wissenschaftlicher Forschung und ihrer Anwendung für die produktive Entwicklung. Er führte eine Studie in 61 Ländern durch und fand einen direkten Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Investitionen in Forschung und Entwicklung. „Die Länder mit dem höchsten Pro-Kopf-Vermögen sind diejenigen, die mindestens 1,5 % ihres BIP in Wissenschaft und Technologie investieren. Diejenigen, die hinterherhinken, investieren weniger als 1 %, so wie wir. Diese Situation hat nun einen kritischen Punkt erreicht.“
 Raquel Chan in einem der Labore des Instituts für Agrobiotechnologie der Küste
Raquel Chan in einem der Labore des Instituts für Agrobiotechnologie der KüsteRaquel Chan: „Die aktuelle Lage ist düster. Ich stimme zu, dass es Dinge gibt, die korrigiert werden müssen, aber was sie tun, zerstört alles“, sagt die leitende Forscherin bei CONICET und Direktorin des Instituts für Agrarbiotechnologie an der Nationalen Universität des Küstenraums (UNCL). Das Institut ist weltweit für die Entwicklung gentechnisch veränderter, dürretoleranter Soja- und Weizensamen bekannt. Dieser Meilenstein der argentinischen Bioökonomie wird von der Firma Bioceres global vermarktet. Chan stellt mit Besorgnis fest, dass Forscher zwischen 40 und 45 Jahren mit staatlich finanzierten Master- und Doktortiteln auswandern. Dies gilt insbesondere für Bereiche wie Ingenieurwesen und Informatik, die für Innovationen von zentraler Bedeutung sind. „Universitätsstudenten, die ihre Karriere beginnen und promovieren möchten, werden durch Stipendien zwischen 700.000 und 900.000 Pesos abgeschreckt. Es liegt nicht daran, dass ihnen die Berufung fehlt; sie können einfach ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten. Wir kämpfen ums Überleben; Reagenzien sind unerschwinglich, Geräte können nicht repariert werden, und das Ministerium übernimmt nicht mehr die Kosten für die elektronische Bibliothek, die uns Zugang zu internationaler Literatur ermöglichte.“
 Marina Simian vom Institut für Nanosysteme an der UnSam entwirft dreidimensionale Organe zum Testen von Medikamenten.
Marina Simian vom Institut für Nanosysteme an der UnSam entwirft dreidimensionale Organe zum Testen von Medikamenten.Marina Simian, promovierte Brustbiologin, erlangte 2019 Bekanntheit durch ihre Teilnahme an der Fernseh-Quizshow „Yo quiero ser millonario“ (Ich will Millionär werden), mit der sie ihr vom CONICET (Nationaler Rat für wissenschaftliche und technische Forschung) gefördertes Labor finanzierte. Sie gewann eine halbe Million Pesos. Während der Pandemie beschloss sie, Unternehmerin zu werden und gründete zusammen mit ihrer Kollegin Adriana Di Siervi das Biotechnologie-Startup Oncoliq, das eine Technologie zur Früherkennung von Brustkrebs in Blutproben entwickelt. Der Test weist eine Sensitivität von 82 % auf, im Vergleich zu ähnlichen Tests in den USA mit nur 30 %. Bezüglich der Regierung merkte sie an: „Bisher wurden die von der Vorgängerregierung verursachten Fehler nicht behoben. Es gibt eine Verordnung für die Gründung technologiebasierter Unternehmen, die eine Partnerschaft mit dem CONICET vorschreibt. Dies stellt jedes Mal ein Problem dar, wenn ein Dokument unterzeichnet oder eine Entscheidung getroffen werden muss. Die Alternative wäre eine sehr hohe Gewinnbeteiligung, was die Sache noch komplizierter macht.“ Andererseits räumt er ein, dass das Arbeitsumfeld unter der Regierung von Alberto Fernández „kirchnerisiert“ wurde, und das erwies sich als nachteilig.
 Keclon Laboratories
Keclon LaboratoriesHugo Menzela: Vor fünfzehn Jahren gründete er Keclon mit, ein Unternehmen, das biotechnologische Enzyme für die Lebensmittel-, Ölsaaten- und Pharmaindustrie herstellt. Heute widmet er sich hauptberuflich der Lehre und der Leitung des Instituts für Biotechnologische und Chemische Prozesse (IProByQ) des CONICET in Rosario, einem Labor, das er zu einer Art Startup-Inkubator und Biotechnologie-Universität ausgebaut hat. „Seit diesem Jahr sind wir eine öffentliche Einrichtung, die ihr gesamtes Budget an das CONICET zurückgezahlt hat, da wir uns selbst tragen. Wir haben etwas mehr als 200.000 US-Dollar von Unternehmen eingeworben, die dem Institut ihr Vertrauen geschenkt haben“, sagt er stolz. Das IProByQ mietet ein Gebäude, in dem Unternehmen untergebracht sind, die Inkubations-, Infrastruktur- und Beratungsleistungen in Anspruch nehmen. Forscher des CONICET sowie Biologen, Chemiker und andere Fachkräfte außerhalb des öffentlichen Sektors arbeiten dort. In diesen Räumlichkeiten findet auch der Abschlussjahrgang des Biotechnologie-Studiengangs der Nationalen Universität Rosario (UNR) statt. „Studierende können lernen, experimentieren, praktische Erfahrungen sammeln und mit wem sie wollen sprechen. Wenn sie eine gute Idee haben, finden wir einen Weg, ihnen eine Plattform zu bieten und sie bei der Finanzierung zu unterstützen“, erklärt Menzella. Bezüglich des Konflikts zwischen Regierung und Wissenschaft räumt Menzella politische Differenzen und widerstreitende Interessen ein. Er warnt jedoch: „Man kann die Wissenschaft nicht zerstören. Dies ist ein Land mit 48 % Kinderarmut und einem erschreckend niedrigen Bildungsniveau. Es geht um alles oder nichts. Also muss man sie fördern, sie unterstützen, ihr das Gefühl geben, die beste der Welt zu sein, und so das Beste herausholen, was möglich ist. In einer Welt, in der der technologische Fortschritt in den letzten fünfzig Jahren der einzige Ausweg aus der Armut war, sollten Bildung, Wissenschaft und Technologie die Norm sein. Es besteht keine Notwendigkeit, das Rad neu zu erfinden.“
Die Herausforderung ist immens. Doch Argentinien birgt, wie auch in anderen Bereichen, großes Potenzial: eine starke wissenschaftliche Tradition und einige der besten Technologieunternehmer Lateinamerikas. Alles , was es dazu braucht, ist politischer Wille und die Fähigkeit, kleinliche politische Differenzen zu überwinden und gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten: das Land.
Clarin